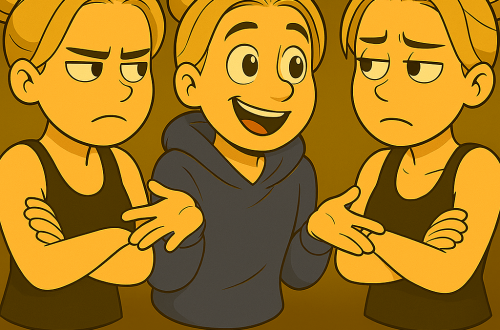Warum ich segle, obwohl das Bordklo streikt und das Rigg klappert

Ein sehr ehrlicher Liebesbrief an Wind, Wellen & Wahnsinn
Ich segle. Nicht, weil es immer schön ist. Nicht, weil alles läuft wie im Prospekt. Ich segle, weil es mich runterbringt, weil ich atmen kann, weil ich dort draußen eine Version von mir finde, die ich an Land manchmal vergesse. Angefangen hat es auf dem Starnberger See, mit meinem Onkel. Ich war klein, die Weste zu groß, die Pinne zu schwer und die Genua zu bösartig. Trotzdem war da dieses Gefühl: Hier gehöre ich hin. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Sonnenuntergang auf dem Wasser: still, rosa-orange, spiegelglatt. Und ich dachte: Das ist größer als alles, was ich sonst kenne.
Heute bin ich Mitbesitzerin einer Bavaria 42 Cruiser, unser Revier ist Istrien. Die Adria, wie aus dem Bilderbuch. Aber halt auch echt: mit drehenden Winden, Seegrasfeldern, Motoren, die zicken, und einem Rigg, das nachts klingt, als hätten sich alle Fallen gegen dich verschworen. Wenn das Boot mal gut läuft, schiebt es mit 7 Knoten, bei 8 feiern wir uns wie Regattaprofis. Und dann kommt eine Wende, die nicht durchgeht, weil jemand (ich) die Genua zu früh dichtgenommen hat. Oder eine Halse bei 25 Knoten, bei der der Baum rüberknallt wie ein wütender Vorschlaghammer. Da denkst du kurz: Das war's.
Und trotzdem bleibst du.
Weil diese Mischung aus Chaos und Kontrolle etwas in dir ordnet. Segeln ist für mich Selfcare, aber nicht die Instagram-Version mit Kerzen und Klangschale. Sondern die, bei der du schwitzend im Cockpit sitzt, das Reff nicht durch die Mastnut willst und du dabei lernst: Geduld. Hingabe. Und loslassen, wenn's nicht anders geht. Es ist Selfcare in der Version mit Salzwasser, Dieselgeruch, blauen Flecken an den Schienbeinen und einem eiskalten Bier in der Plicht nach einem harten Schlag. Es ist das beruhigende Rauschen der Wellen, das manchmal mehr heilt als jedes Gespräch.
Kroatien ist dabei nicht nur Kulisse, sondern ein Geschenk. Die kargen Felsküsten, das kristallklare Wasser, die kleinen Konobas mit Grillfisch und Hauswein – es ist, als hätte jemand die perfekte Postkarte einfach in die Wirklichkeit gezaubert.
Klar, es gibt die Hafendramen. Ich erinnere mich an ein Anlegemanöver mit Seitenwind, das ich souverän versauen wollte. Der Wind dachte sich: "Nö." Unser Boot drehte sich sanft, aber unaufhaltsam, direkt gegen den Steg. Zwölf Zuschauer. Absolute Stille. Ich bin mir ziemlich sicher, einer hatte Popcorn. Auch nicht schlecht: Die Bordtoilette, die bei Seegang rückwärts druckbetankt wird und dann entscheidet, dass sie ihren Dienst einstellt. Da hilft dann keine Meditation. Nur Humor. Und Handschuhe. Und dann ist da das Drama mit der Crew. Zwei Leute, die sich um die richtige Ankermethode streiten, während du versuchst, das Boot auf Kurs zu halten. Einer, der Backbord mit Steuerbord verwechselt. Immer jemand, der den wichtigsten Moment verpasst, weil er "nur kurz unter Deck" war. Und natürlich der Klassiker: die Seekranke, die in der Kvarner-Bucht über dem Süllrand hängt, während du versuchst, bei einsetzendem Bora-Böen-Chaos irgendwie das Vorsegel zu bergen, das sich natürlich genau in dem Moment im Vorstag verhakt. Die Kvarner-Bucht ist kein Ort für Fehler. Wenn die Bora einsetzt, wird das Meer weiß, der Himmel flach und das Adrenalin real. Da hilft kein Wetterbericht, nur ein gutes Reff und ein noch besserer Plan B.
Und ja, das Rigg klappert. Immer. Vor allem nachts. Du sicherst alles doppelt, aber irgendein Karabiner will dich einfach fertig machen. Dann sitzt du da, irgendwo zwischen Ankerboje und innerer Unruhe, und merkst: Du bist ganz da. Wach. Echt. Und in diesem Chaos, das Segeln nun mal ist, findest du seltsamerweise Klarheit. Wenn der Himmel in Orange- und Lilatönen brennt, das Wasser glitzert, und die Hitze des Tages langsam aus dem Deck zieht, dann denkst du: Ja. Dafür. Für genau das hier.
Ich segle nicht, weil es einfach ist. Ich segle, weil es mich zwingt, präsent zu sein. Weil ich auf dem Wasser loslasse, was ich an Land festhalte. Und weil ich spätestens beim dritten Versuch, das Boot sauber in die Box zu bringen, weiß: Das Leben ist genau wie das Anlegen. Manchmal klappt's. Manchmal halt nicht. Aber beides ist richtig.
Und falls du dich fragst, warum ich mir das immer wieder antue: Weil Segeln wie ein schlechter Witz mit perfekter Pointe ist. Erst fluchst du, dann lachst du – und am Ende willst du sofort nochmal. Außer das Bordklo ist wieder voll. Dann vielleicht erst morgen.
- Zoya 💜⚓